
Studiengebühren bedeuten weniger Studierende
Fakt ist, dass jegliche Art von Zugangsbeschränkungen an Hochschulen eine Senkung der Studierendenzahlen zur Folge hat. Durch die Einführung der Studiengebühren im Jahr 2001 haben 45.000 Studierende ihr Studium abgebrochen. Die Anzahl an Doktoratsstudierenden ist zurückgegangen, der Frauenanteil in dieser Gruppe erheblich gesunken. Wir brauchen aber nicht weniger, sondern mehr AkademikerInnen. Im internationalen Vergleich hinkt Österreich hinterher: Gerade mal 19% der 25–64 jährigen ÖsterreicherInnen haben 2009 einen Bildungsabschluss im tertiären Bereich. Der OECD-Durchschnitt liegt bei 30%. Die StudienanfängerInnenquote in Österreich liegt ebenfalls deutlich unter dem OECD- und EU-Durchschnitt. Das belegt jedes Jahr die Studie der OECD „education at a glance.“
Studiengebühren verstärken die soziale Selektion
Soziale Selektion, also die Benachteiligung aufgrund der sozialen Herkunft ist an österreichischen Universitäten eklatant: Derzeit hängt in Österreich die Entscheidung ob ein Studium begonnen wird, immer noch maßgeblich vom Bildungsgrad der Eltern, der sozialen Schicht, der schulischen Vorbildung und der regionalen Herkunft ab. 1990 waren Kinder von MaturantInnen oder AkademikerInnen unter den StudienanfängerInnen noch um den Faktor vier überrepräsentiert (das bedeutet: Die Wahrscheinlichkeit, ein Studium zu beginnen, war für diese Kinder viermal so hoch wie für andere). Heute ist die Wahrscheinlichkeit für AkademikerInnenkinder noch immer 3mal so groß, ein Universitätsstudium zu beginnen. Noch deutlicher wird die Schieflage im Hochschulzugang bei Betrachtung des Schichtindex.
Hier werden neben dem Bildungsabschluss der Eltern auch die jeweiligen beruflichen Positionen und das Einkommen der Eltern berücksichtigt: Nur ein knappes Fünftel aller Studierenden kommt aus einer niedrigen sozialen Schicht. Studiengebühren verschärfen die soziale Schieflage an österreichischen Universitäten zusätzlich. 2001 hat die Einführung der Studiengebühren nachweislich zu einem deutlichen Rückgang des Anteils von Studierenden aus bildungsfernen Schichten geführt. Gleichzeitig ist die Erwerbsquote unter Studierenden gestiegen. Das Argument, Studierende, die sich Studium beziehungsweise Studiengebühren nicht leisten können, bekämen Studienbeihilfe, ist unter dem aktuellen Studienförderungssystem schlichtweg falsch. Es ist weder sozial treffsicher noch sind Höhe und Ausmaß ausreichend. Lediglich ein Viertel der Studierenden erhält eine staatliche Studienförderung.
Wird bedacht, dass weit über die Hälfte aller Studierenden erwerbstätig sein müssen, um finanziell auszukommen, werden die Missstände ersichtlich. Trotz Studiengebühren ist die Anzahl der StudienbeihilfenbezieherInnen nicht gestiegen. Viele Studierende mussten ihr Studium aus finanziellen Gründen abbrechen. Studiengebühren erhöhen zusätzlich den Druck, so schnell wie möglich zu studieren, meist neben der Erwerbstätigkeit. Als Resultat davon bleiben Doppelstudien oder weiterführende Studien wie Master und Doktorat den sozial besser gestellten Schichten vorbehalten.
 Studiengebühren fördern die Ungleichverteilung von Bildungskapital
Studiengebühren fördern die Ungleichverteilung von Bildungskapital
Gerade in konservativen Kreisen wird die Umverteilungswirkung von Studiengebühren gepriesen. Nachdem die meisten Studierenden aus gut situierten Haushalten kommen, würde allerdings eine Bildungsabgabe mehr soziale Verteilungsgerechtigkeit bringen. Die propagierte „Umverteilungswirkung“ von oben nach unten durch Studiengebühren verschärft schlussendlich die soziale Selektion und macht noch weniger Menschen aus bildungsfernen Schichten ein Hochschulstudium zugänglich. Somit führen Studiengebühren in letzter Konsequenz zu einer weiteren gesellschaftlichen Ungleichverteilung von Bildungs- und folglich ökonomischem Kapital.
Studiengebühren lösen die Unterfinanzierung der Universitäten nicht
Österreichs Universitäten sind chronisch unterfinanziert. Internationale Vergleiche zeigen, dass Österreich noch immer zu wenig in den Hochschulsektor investiert. Schon seit dem Vertrag von Lissabon gibt es seitens der europäischen Regierungen das Ziel, die Investitionen auf 2% des BIP aufzustocken. Mit rund 1,3% des BIP (Stand 2010) liegt Österreich weit unter dem OECD-Schnitt von 2%. Von einer Verbesserung in diese Richtung ist allerdings wenig zu spüren: Die Ausgaben pro StudentIn sind seit 2002 kontinuierlich gesunken. BefürworterInnen von Studiengebühren betonen die Verbesserung der finanziellen Situation von Universitäten und folglich auch die erhöhte Qualität in Lehre und Forschung durch „faire und verhältnismäßige“ private Beiträge. Realität ist allerdings, dass sich auch mit der Einführung der Studiengebühren die finanzielle Lage an den Universitäten kaum verbessert hat. Alleine die von der ehemaligen 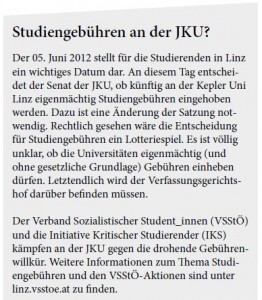
Studiengebühren führen also zu einem drastischen Rückgang der Studierendenzahlen, die soziale Selektion an den Hochschulen verschärft sich zusätzlich, die Elitenbildung wird weiter gefördert und dabei kommt es zu keiner Verbesserung der finanziellen Situation der Universitäten, es sei denn die Studiengebühren wären unverhältnismäßig hoch.
Bei diesen Fakten wird klar, dass es bei der Finanzierung des Bildungswesens um eine Frage der Gerechtigkeit geht. Aus sozialdemokratischer Sicht sind Studiengebühren daher abzulehnen. Ziel muss es daher sein, in unserer Gesellschaft Chancengerechtigkeit gerade im und über den Bildungsbereich herzustellen.


